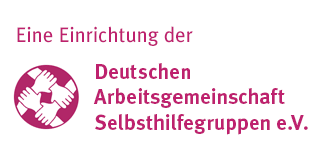Familienfreundliche Engagementförderung durch Selbsthilfekontaktstellen
Im Rahmen ihrer Unterstützungsarbeit haben Selbsthilfekontaktstellen mit vielfältigen Familienbezügen der Menschen und Selbsthilfegruppen vor Ort zu tun.
Selbsthilfekontaktstellen wollen Zugänge, Begegnung und Handlungsmöglichkeiten schaffen. Das gilt unmittelbar praktisch zum Beispiel für mobilitätseingeschränkte Menschen, aber auch für alle anderen Nutzer*innen der Angebote.
Immer geht es dabei um die Berücksichtigung von Lebenssituationen, Belastungen, Arbeits- und Familienzusammenhängen und um passende Rahmenbedingungen, zum Beispiel gute Erreichbarkeit, flexible Öffnungszeiten, angemessene Räumlichkeiten, nützliche Ausstattung mit Arbeitsmitteln.
1. Familienfreundliche Rahmenbedingungen in Selbsthilfekontaktstellen
Ein offener, niederschwelliger Zugang und eine zentrale Lage (gute verkehrsmäßige Erreichbarkeit) sind selbstverständliche Maximen von Selbsthilfekontaktstellen.
Die Nutzung der Räumlichkeiten und der technischen Ausstattung einer Selbsthilfekontaktstelle ermöglichen die Zusammenkunft und die Arbeit der einzelnen Gruppen und eröffnen darüber hinaus die Begegnung mit Mitgliedern anderer Gruppen.
Die Öffnungszeiten von Selbsthilfekontaktstellen sind an den Bedürfnissen der Interessierten und Gruppen orientiert; das heißt, dass sowohl während der üblichen Arbeitszeiten / Geschäftszeiten als auch an Abenden und gegebenenfalls am Wochenende Angebote und Ressourcen der Kontaktstelle – also familienfreundlich – genutzt werden können.
Spezielle familienfreundliche Rahmenbedingungen (zum Beispiel Kinderbetreuung, kindgerechte Aufenthaltsmöglichkeiten wie Spielzimmer, offene Begegnungsmöglichkeiten / Treffs, behinderten- und seniorengerechte Zugänge und Arbeitsmittel) sind in hohem Maße ausstattungs- bzw. ressourcenabhängig und damit nicht immer gegeben.
2. Konzeptionelle Offenheit der Selbsthilfekontaktstellen zur Stärkung von Familien und familienbezogenen Netzwerken
Das Arbeitskonzept von Selbsthilfekontaktstellen ist grundsätzlich offen. Die Stärkung von Familien und familienbezogenen Netzwerken ist damit möglich. Selbsthilfekontaktstellen können bei der Verbesserung von Angeboten für Familien, bei der Erhöhung von Familienkompetenz und der Trägfähigkeit sorgender Netze mitwirken und entsprechende Vorhaben anregen.
Bei der Begleitung von Gruppen werden familiäre Belange in die Gruppenarbeit und in die Öffentlichkeitsarbeit umso wahrscheinlicher einbezogen als diese auch unmittelbar Gegenstand der Gruppen sind (zum Beispiel Eltern-Kind-Gruppen; Gruppen von Eltern behinderter Kinder; Gruppen Alleinerziehender; Gruppen pflegender Angehörige; Gruppen sorgender Eltern nach Trennung und Scheidung; Elternkreise suchtgefährdeter Kinder und Jugendlicher; aber auch: Gruppen von Kindern suchtkranker Eltern).
Selbsthilfekontaktstellen benötigen für die Entwicklung von Angeboten zur Stärkung von Familien und familienbezogenen Netzwerken allerdings eine angemessene personelle und sächliche Ausstattung.
3. Empowerment: Das Besondere in Selbsthilfekontaktstellen
Die Fachlichkeit von professionellen Selbsthilfeunterstützer*innen in Selbsthilfekontaktstellen zielt darauf, den Selbsthilfekräften bei den Einzelnen und in der Gruppe zur Entfaltung zu verhelfen (Empowerment-Ansatz). Bei der Beratung von Interessierten wie bei der Gründungshilfe und Begleitung von Gruppen wirken sie anregend, stabilisierend und bekräftigend. Sie fördern und stärken dabei die Betroffenen- und Solidarkompetenz.
Die Unterstützer*innen haben die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu sichern, Klärungshilfe zu leisten, Wegbereitung und Feedback anzubieten. Dafür tragen sie die Verantwortung, nicht jedoch für die Ziele und die spezifische Problembearbeitung einer Gruppe wie etwa eine bessere Ausgestaltung sozialer Netze für Familien, die Vertretung familiärer Belangen in der Öffentlichkeit, die Verbesserung von Teilhabechancen von Kindern, Senioren, Eltern … Dafür sind und bleiben die Selbsthilfeengagierten und ihre Gruppen selbst verantwortlich.
4. Verbreitung von Selbsthilfekontaktstellen
In Deutschland gibt es gegenwärtig rund 300 Selbsthilfeunterstützungseinrichtungen (örtliche Selbsthilfekontaktstellen / Selbsthilfeunterstützungsstellen und überregional arbeitende Einrichtungen). Die NAKOS verzeichnet diese in ihrer Adressdatenbank ROTE ADRESSEN.